Mit der Digitalisierung müssen sich Banken neu erfinden. Das Geschäftsmodell wird sich ändern – Open Banking sorgt dafür – doch die Beziehung zum Kunden wird weiterhin wichtig bleiben.
Text: Pascal Hügli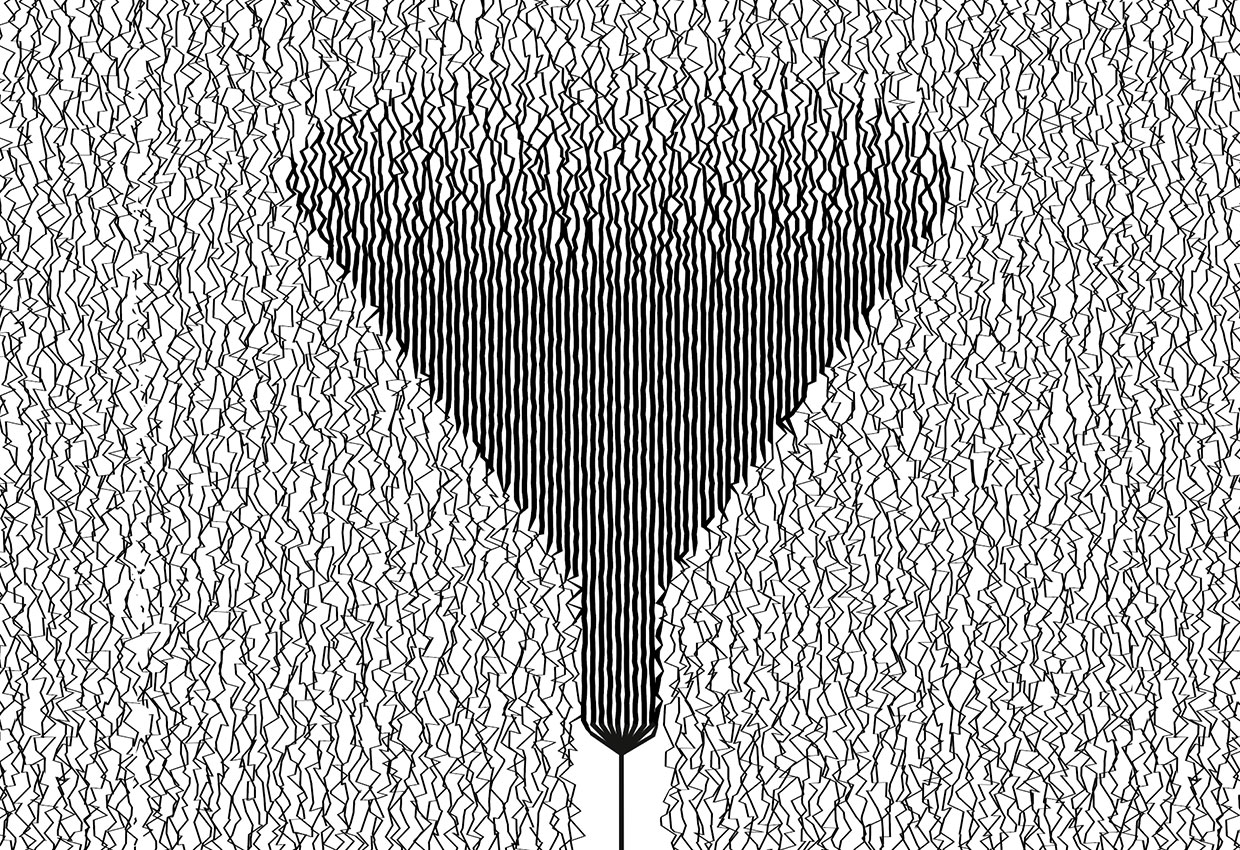
Mit der digitalen Transformation geht die Zeit der klassischen Universalbank zu Ende. Seit Jahren ist zu beobachten, wie traditionelle Wertschöpfungsketten aufgebrochen werden – insbesondere durch die Techgiganten Google, Amazon und Co. Genauso mischen aber auch innovative Startups mit. Revolut, Viac oder Neon sind heute vielen ein Begriff.
Dank der digitalen Entwicklung haben Kunden heute nicht nur eine grössere Auswahl, sie können die Optionen auch einfacher realisieren. Immer mehr Kunden agieren gemäss einem eigenen «Best-of-Class»-Ansatz. Sie wählen denjenigen Anbieter, der einem in der jeweiligen Sparte am besten gefällt, am günstigsten ist und den komfortabelsten Service bietet. Die Aufspaltung der Wertschöpfungskette sowie der Wandel von der Universalbank hin zu einem Potpourri an Finanzdienstleistern sorgt jedoch auch für mehr Komplexität.
Laut einer Studie von Crealogix pflegen 42 Prozent der jüngeren Bankkunden Beziehungen zu mehr als zwei Finanzinstituten – Tendenz steigend. Wie die Studie ebenfalls herausgefunden hat, wünschen sich 41 Prozent der Befragten auch eine App, in der alle Banken, finanziellen Informationen und Dienstleistungen zusammengefasst sind und die so einen konsolidierten Überblick der eigenen Finanzen bietet.
Wo es für die Schweiz drauf ankommt
Um diesen Trend abfangen und den Kunden die Bündelung vereinfachen zu können, hat man sich in der EU mittels PSD2- Richtlinie dem Thema des Open Bankings angenommen. Dabei werden Banken dazu verpflichtet, ihre Schnittstellen für Drittparteien zu öffnen. Denn nur wenn diese über alle Finanzinstitute hinweg offen sind, werden Kunden die Komplexität reduzieren und ihre Finanzen auf einen gemeinsamen Nenner bringen können.
Die Schweiz ist als EU-Nichtmitglied von PSD2 nicht betroffen. Eine ähnliche Regulierung wird abgelehnt, da sie gemeinhin als staatliche Zwängerei angesehen wird. Viel eher vertraut man auf den Markt, der darüber entscheiden soll, wie Banken und Drittanbieter zusammen Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Mit dieser Herangehensweise mache man es sich zu einfach, wird denn auch Kritik laut, ohne Druck respektive Regulierung werde nichts geschehen.
Das Verweigern von Open Banking würde den Schweizer Banken mittelfristig mehr schaden als nutzen. Und innovative Fintechs würden sich fürs Ausland entscheiden, so die Befürchtung. Interessanterweise dürfte für die Schweiz Open Banking im Bereich von Konto- und Zahlungsinformationen – wie von PSD2 angestrebt – allerdings weniger entscheidend sein. Als weltweite Nummer 1 in der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung ist es daher viel wichtiger, auf diesem Gebiet die Öffnung der Schnittstellen voranzutreiben. Gerade in der Vermögensverwaltung ist Open Banking auch international bisher nur bei wenigen auf dem Radar. Macht die Schweiz hier vorwärts, könnte sie sich hier wiederum einen Vorsprung verschaffen.
Frontend für den Kunden
Obwohl standardisierte Schnittstellen noch fehlen, haben sich einige Anbieter bereits am Markt positioniert. Seit 2015 ist WealthArc auf dem Markt. Als Software-as-a-Service-Unternehmen bietet das Start-up unabhängigen Vermögensverwaltern, Family Offices sowie Privatbanken eine vollautomatisierte Plattform zur gezielten Konsolidierung und effizienteren Handhabung von Vermögenswerten.
Neben WealthArc gibt es weitere solche Portfoliomanagement-Lösungen für die B2B-Industrie, zum Beispiel Expersoft, Assetmax, Alphasys oder OnePM. Alle diese «Datenmaschinen» unterhalten eine Menge Schnittstellen zu den hiesigen Banken, bei WealthArc sind es über 35. Deren Schnittstellen gesteuerte Portfolio-Software ermöglicht einen vollautomatischen Datenaustausch und bringt Vermögensverwaltern einen Mehrwert in Form von Kostensenkungen sowie Leistungssteigerung, der letztlich an den Endkunden weitergereicht werden kann. Darüber hinaus besitzt WealthArc ein Frontend, über das ein jeder Vermögensverwalter die Möglichkeit hat, seinen Endkunden Zugang zum Portfolio zu verschaffen.
Ebenfalls auf das Frontend konzentriert man sich bei Altoo. Das WealthTech-Unternehmen mit 24 Mitarbeitern bietet eine Software, die als digitales Family Office fungiert. Über die Benutzeroberfläche lassen sich alle persönlichen Vermögenswerte aggregieren, ob Aktien, Anleihen, Währungen, Immobilien, Kunstgegenstände oder Kryptoassets. Gleichzeitig lassen sich die spezifische Allokation sowie Wertveränderungen der entsprechenden Anlageklassen abrufen. Die Altoo-Plattform ist somit eine Technologie, die dem vermögenden Privatkunden das Leben vereinfacht und das Ende von manueller Konsolidierung mit Excel-Datei und den Regalen voller Ordner mit Verträgen, Bankauszügen und Versicherungspolicen einläutet.
Open Banking fördert neue Geschäftsmodelle
Als Daten-Aggregator besitzt Altoo gegenwärtig Schnittstellen zu 35 Banken in der Schweiz. Zum heutigen Zeitpunkt gilt das Angebot den sehr vermögenden Kunden, da für sie Open Banking bereits eine Realität ist, und Banken ihnen aufgrund ihres Stellenwertes jede Schnittstelle ermöglichen. Altoo sieht sich hier als Vorreiter. Bis in fünf Jahren dürfte aber auch das Gros der wohlhabenden Privatkunden von solchen Dienstleistungen profitieren zu können. Denn um ihre Kunden nicht zu verlieren, werden sich Banken stärker öffnen und selbst zu Aggregatoren werden müssen.
Jene Bank, die als Plattform für verschiedene Dienstleister fungiert und zugleich möglichst viele Schnittstellen aufweisen kann, wird einen Wettbewerbsvorteil haben. Das bedingt natürlich auch das Selbstbewusstsein, einen Kunden über die eigene Plattform externe Dienstleistungen konsumieren zu lassen. Revolut wird man in seiner Nische der Fremdwährungsgebühren kaum schlagen können. Lässt man als Bank einen Kunden diese App trotzdem über die eigene Plattform nutzen, bleibt die Kundenbeziehung und damit das wertvollste Asset für ein Finanzinstitut erhalten.
In Zukunft wird die direkte Beziehung zum Kunden für eine Bank zum kritischen Faktor, um noch immer Geld verdienen können. Das Geschäftsmodell wird sich jedoch ändern: Traditionelle Geschäfte wie Kontoführung, Depotverwahrung oder Wertschriftenhandel werden nicht mehr viel Ertrag abwerfen. Viel wichtiger wird es künftig, für gute Beratung auch Geld verlangen zu können, so wie es Rechtsanwälte und Steuerberater auch schon tun.
Dass die Beratung ihr Geld auch wert sein soll, dafür soll die Nutzung von relevanten Daten sorgen. Indem die entsprechenden Daten ausgewertet und verwendet werden, soll die Beratung gezielter auf den Kunden angepasst werden können. Kennt eine Privatbank die Details der gesamten Vermögenssituation des Kunden, sind die Empfehlungen entsprechend besser abgestimmt und nachhaltiger. Natürlich muss dafür gesorgt sein, dass der Kunde die Datenhoheit behält und darüber entscheiden kann, wer welche Daten erhalten soll. Nur so dürfte er bereit sein, seine Daten zu teilen.
Heue ist die Welt für das Datengeschäft im Banking noch nicht bereit. Insbesondere den sehr vermögenden Kunden ist ihre Privatsphäre wichtig. Nur schon die Tatsache, dass sie alle Daten und Assets an einer Stelle aggregieren lassen, ist ein riesiger Schritt. In der Vergangenheit waren Finanzdienstleister vor allem darum bemüht, möglichst hohe Anlagevolumen zu erzielen. In Zukunft macht das Rennen, wer das Vertrauen des Kunden und seine Daten gewinnt, um darauf basierend gute Beratung zu erbringen







